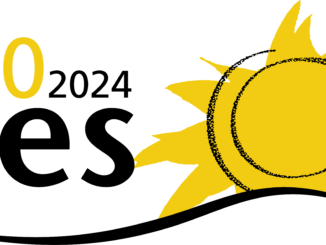Aktuell ist politisch viel im Umbruch im Energiebereich. Ob dies schlussendlich für den Ausbau der Photovoltaik nützlich sein wird oder nicht, lässt sich noch nicht abschliessend sagen. Zumindest erklärt Energieexperte und alt Nationalrat Rudolf Rechsteiner im zweiten Teil des Interviews zu seinem Buch «Energiewende im Wartesaal», welche Stolpersteine die Politik noch aus dem Weg räumen müsste, um dem massiven Ausbau der Solarenergie den Weg zu bereiten.
Zur Person
 Rudolf Rechsteiner (62) ist Ökonom und war als Basler SP-Nationalrat (1995–2010) massgeblich an der Einführung der kostendeckenden Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energien beteiligt. Er ist Lehrbeauftragter für erneuerbare Energien an der Universität Basel und an der ETH Zürich. Er amtiert seit 2010 als Verwaltungsrat der Industriellen Werke Basel (IWB) und war zuvor Präsident der ADEV-Energiegenossenschaft (Liestal [BL]). Dies ist der zweite Teil eines längeren Interviews, der erste Teil ist in der EE-Ausgabe 4/2021 im August erschienen.
Rudolf Rechsteiner (62) ist Ökonom und war als Basler SP-Nationalrat (1995–2010) massgeblich an der Einführung der kostendeckenden Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energien beteiligt. Er ist Lehrbeauftragter für erneuerbare Energien an der Universität Basel und an der ETH Zürich. Er amtiert seit 2010 als Verwaltungsrat der Industriellen Werke Basel (IWB) und war zuvor Präsident der ADEV-Energiegenossenschaft (Liestal [BL]). Dies ist der zweite Teil eines längeren Interviews, der erste Teil ist in der EE-Ausgabe 4/2021 im August erschienen.
Beat Kohler: Wie beurteilen Sie angesichts der Forderungen, die Sie in Ihrem Buch aufstellen, die aktuelle Debatte zum Energiegesetz?
Rudolf Rechsteiner: Überraschend positiv. Der Beitrag, den die Photovoltaik sehr kostengünstig leisten kann, scheint plötzlich über alle politischen Lager hinweg unbestritten. Und endlich wurde ein Geschäftsmodell geschaffen für Anlagen ohne Eigenverbrauch. Der Weg über differenzierte, wettbewerbliche Auktionen wurde akzeptiert. Trotzdem fehlen noch einige ganz wichtige Elemente.
Was genau meinen Sie?
Neu wurden etwa 0,8 Rp./kWh aus dem Netzzuschlag für die Wasserkraft zweckgebunden. Das ist eine enorme Erhöhung für einen Energieträger, bei dem ein Zubau an Neuanlagen realistisch betrachtet kaum mehr möglich ist. Dieses Geld ist bei der Modernisierung von bestehenden Kraftwerken gut investiert, wird nun aber der Photovoltaik fehlen. Zum Zweiten ist die Bewilligungsblockade beim Zugang der Photovoltaik auf Infrastrukturflächen oder Brachen überhaupt nicht gelöst. Wer einen Autobahnzaun, die Lärmschutzwände der SBB, eine alte Deponie ausserhalb der Bauzone oder eine Hausfassade für Photovoltaik nutzen will, muss sich auf eine riesige Bürokratie mit mehrjährigen Verfahren gefasst machen. So kommen wir nie zum gewünschten Ausbau der Photovoltaik und zu mehr Winterstrom. Ganz falsch finde ich die Absicht im Mantelerlass, nur die Pumpspeicherwerke einseitig von Netzgebühren bei der Strombeschaffung zu befreien und die Batterien nicht. Batterien würden gesetzlich zweimal mit Netzgebühren belastet. Was sich das BFE dabei überlegt hat, ist mir rätselhaft. Die BFE-Leute wollen mit Innovationen die Nase vorne haben, verschlafen aber die global wichtigste Entwicklung, wenn sie Batteriespeicher faktisch verbieten.
Welchen Eindruck hatten Sie von den Debatten zur parlamentarischen Initiative Girod?
Es schien, als ginge ein Ruck durchs Parlament. Seit dem Abbruch der Verhandlungen um ein Rahmenabkommen dämmert es manchen, dass die Stromlieferungen aus der EU besonders bei Engpässen nicht mehr selbstverständlich sein werden. Die Ja-Mehrheiten waren erstaunlich solide, fast einstimmig, und das Tempo der Beratungen ungewöhnlich. Man war sich einig und verzichtete auf eine neue Vernehmlassung. Man könnte fast eine Zeitenwende vermuten, nach einem Jahrzehnt voller Blockierungen. Wie nachhaltig diese ist, wird sich erst noch zeigen.
Darf sich die Solarbranche auf ein neues Energiezeitalter freuen?
Dafür ist es definitiv noch zu früh. Bei der Umsetzung hängt vieles vom Bundesamt für Energie und vom Bundesrat ab. Im Mantelerlass, der nun zur Erstberatung in den Ständerat kommt, ist zum Beispiel noch immer der Antrag enthalten, die Tarifstrukturen so zu ändern, dass Netzgebühren pauschal verrechnet werden dürfen. Dies könnte mittels eines erhöhten Grundpreises oder als Leistungstarif geschehen. Das wäre dann das Todesurteil für viele Solarstromprojekte, die heute dank Eigenverbrauch und garantierter Einsparung von 70% der Netzgebühren rentieren. Eine solche Anpassung wäre eine Dummheit sondergleichen, die auch dem Streben nach Stromeffizienz diametral zuwiderlaufen würde. Das BFE suggeriert hier angebliche Ungerechtigkeiten. In Wirklichkeit ist es aber so, dass ein grosser Stromkonzern nicht weit vom Bundeshaus die dezentrale Stromerzeugung nach wie vor bekämpft und sich das Bundesamt vor den Karren gespannt hat.
Können höhere Grundpreise noch verhindert werden?
Gegen höhere Grundpreise würde ich sogar ein Referendum in Betracht ziehen. Wenn wir anfangen, die Netzgebühren als Pauschalen zu verrechnen, und dies ohne hohe Rückliefertarife, dann gefährden wir alles, was wir eigentlich wollen und was in der Bundesverfassung als Ziel verankert ist: die Produktion von dezentralen erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz. Und die kleinen Kundinnen und Kunden erhalten erst noch höhere Stromrechnungen, was ich völlig unsozial finde. Vorerst habe ich noch Hoffnung, dass das Parlament diesen Vorschlag des BFE aus dem Gesetz kippen wird.
Wie beurteilen Sie das vorgesehene System der Investitionsbeiträge?
Die Erteilung der «richtigen» Investitionsbeiträge mit dem jetzigen System ist hoch problematisch. Da riskiert man grosse Mitnahmeeffekte: Es werden Anlagen bevorschusst, die bei den aktuellen Preisen am Strommarkt von über 10 Rp./kWh gar keine Unterstützung benötigen. Die Herausforderung ist, dass niemand weiss, wo die Strompreise während der 20 Jahre Amortisationszeit der Anlagen genau stehen werden. Deshalb wäre es sinnvoll, Auktionen mit gleitender Marktprämie statt der Investitionsbeiträge zu verankern. Dadurch würden die Investorinnen und Investoren mit den kostengünstigsten Projekten einen Anspruch auf einen wettbewerblich ausgeschriebenen Lieferpreis erhalten, so wie im Ausland. Die Differenz bei tiefen Strompreisen würde mit einer Marktprämie ergänzt. Ein Vorteil dieses Systems ist: Niemand muss sich mit Preisszenarien beschäftigen, bei Preisen, die so oder so politisch in Brüssel gemacht werden, durch die Festlegung der zugelassenen CO2-Emissions-Zertifikate.
Wo liegt der Unterschied zwischen Investitionsbeiträgen und gleitender Marktprämie für den Bund?
Bei Strompreisen von 10 Rp./kWh und mehr, wie sie derzeit bezahlt werden, könnten grosse PV-Anlagen ganz auf Beiträge aus dem Netzzuschlagsfonds verzichten. In den Auktionen wird ja immer nur ein Mindestpreis vereinbart. Die Anlagen würden dann ganz aus dem Markt finanziert. Die Einnahmen aus dem Netzzuschlag würden bei hohen Strompreisen im Fonds bleiben. Die Absicherung nach unten bewirkt aber, dass sich auch kleine und mittlere Investoren mittels Projektfinanzierungen sehr günstig verschulden können. Und zudem: Halten die hohen Strompreise noch einige Zeit an, wofür vieles spricht, werden die grossen PV-Anlagen einen mehrjährigen Abnahmevertrag zu fixen Preisen ergattern. Das würde auch die Auktionsgebote sofort absinken lassen, wenn, sagen wir, die Hälfte der Kapitalkosten einer Anlage vertraglich schon nach sechs Jahren amortisiert wären.
Und wie steht es mit dem Risiko für den Bund, das das BFE immer wieder betont?
Das sind Ausflüchte. Der Bund hat die gesetzliche Aufgabe, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Also soll er auch helfen, die Risiken zu tragen. Die Photovoltaik ist für den Bund selbst dann problemlos tragbar, wenn die Strompreise später einmal stark fallen sollten. Denn die PV-Gestehungskosten sind nur halb so hoch wie jene aller anderen Technologien. Und der Bund könnte in guten Zeiten Rückstellungen vorsehen.
Und was wäre mit dem geplanten Winterzuschlag im Stromversorgungsgesetz?
Den würde ich auf alle Fälle einführen. Damit lassen sich Leistungen finanzieren, die weit über die Photovoltaik hinausgehen, neue Speicher zum Beispiel. Die Verwendung des Winterzuschlags muss unbedingt technologieoffen definiert werden. Damit sollten auch zusätzliche Produktionsanlagen mit erhöhten Lieferungen im Winterhalbjahr finanziert werden, zum Beispiel an alpinen Lagen, und nicht bloss zusätzliche Speicher. Die vom Bundesrat verlangte «Abrufbarkeit» führt ja zu einer schweren Diskriminierung der Photovoltaik, und das war wohl genau der Zweck. Dabei ist es doch völlig egal, an welchem Tag und zu welcher Tageszeit der Winterstrom fliesst, Hauptsache die Wasserspeicher werden geschont.
Wie wollen Sie mehr Winterstrom aus Photovoltaik organisieren?
Für eine Ausrichtung aufs Winterhalbjahr braucht es Anreize in den Auktionen, indem man zum Beispiel nur die Gestehungskosten ausserhalb des Hochsommers – zwischen Mitte September und Mitte Juni – finanziell mit der gleitenden Marktprämie absichert, dann würde die Ausrichtung bei der Aufstellung der Solarmodule in steiler Ost-West-Richtung oder mit bifazialen Modulen in senkrechter Aufstellung nach Süden automatisch auf den Winter ausgelegt, und wir würden auch der Kannibalisierung der Strompreise vorbeugen. Die Anlagen in Ost-West-Ausrichtung geben ebenso viel Winterstrom, aber mehr Elektrizität an den Tagesrändern als am Mittag. Natürlich helfen auch Batterien, aber die braucht es erst später.
Sie sagen, dass sehr vieles vom Bundesrat abhängt. Dieser hat aber inzwischen den Willen geäussert, dass er die erneuerbaren Energien massiv ausbauen will. Was braucht es jetzt dafür?
Erstens Bewilligungserleichterungen. Wer Anlagen auf bereits versiegelten Flächen oder auf Infrastrukturen erstellt, sollte nur noch ein Meldeverfahren durchlaufen müssen, wenn das Projekt gewisse Bedingungen erfüllt, die der Bundesrat in der Verordnung definieren könnte. Zweitens sollten die Auktionen unterschiedliche Topografien berücksichtigen: separate und abgestufte Ausschreibungen für Anlagen auf Dächern, an Verkehrswegen, auf Parkplätzen, an Zäunen, auf Stauseen und auf anderen Infrastrukturflächen. So können Anlagen in der offenen Landschaft gering gehalten werden, und es werden weniger Widerstände provoziert. Das Schlimmste wären Blockaden wie bei der Windenergie. Drittens sollte man wie gesagt den Winterstrom besonders gewichten und dafür an Standorten mit hoher Wintereinstrahlung, zum Beispiel an Lawinenverbauungen, die erhöhten Kosten für die Netzanschlüsse übernehmen. Wer heute in der Nordsee in eine Windfarm investiert, um Winterstrom zu liefern, der bezahlt die Steckdosen, Umrichter und Stromleitungen auf hoher See auch nicht selbst. Diese Kosten tragen in Europa überall die Netzbetreiber. Das war übrigens auch in den USA so, zum Beispiel in Texas, als man ab 2007 sogenannte wettbewerbliche Erneuerbare-Energien-Zonen einführte, mit voller Kostendeckung der Stromanschlüsse durch die Netzbetreiber für die Anlagen weit im Westen, in der Halbwüste. Eine Lösung wie in Texas täte der Schweiz gut, wenn sie auf Infrastrukturen in der Peripherie mehr Winterstrom gewinnen will. Und zu guter Letzt sollte man auch die Einmalvergütung für Kleinanlagen an Fassaden und auf Dächern erhöhen, denn die maximal zulässigen 30% der Investitionskosten werden heute stark unterschritten. Das Gesetz müsste sagen, dass sich der Bundesrat an den Mediankosten der jeweiligen Leistungsklasse orientieren soll, dann kommen mehr gute Standorte an den Gebäuden ins Spiel.
Warum drängt die BKW auf Investitionsbeiträge und die Axpo will die gleitende Marktprämie?
Schauen Sie: Investitionsbeiträge sind etwas für grosse Investoren mit voller Kriegskasse. Im BKW-Versorgungsgebiet galten jahrelang die höchsten Stromtarife, die BKW hat ihre Kundinnen und Kunden gemolken. Die Berner Regierung liess dies geschehen und senkte auch noch die Wasserzinsen. Dies aus Angst, die BKW könnte die Entsorgung des AKW Mühleberg nicht bezahlen. Dieses Problem hat sich aber erledigt. Heute will die BKW grosse PV-Anlagen bauen und hat das nötige Geld für die weitere Expansion. Die Axpo ist ganz anders aufgestellt. Sie hat weniger Kapital, wird noch jahrelang für den Rückbau ihres riesigen Atomparks bezahlen und möchte eigentlich auch in erneuerbare Energien investieren. In der Axpo hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Da sind jetzt junge, intelligente Manager, die sich aber stärker fremd verschulden müssen für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und das ist mit gleitender Marktprämie viel einfacher und billiger, da geben die Banken gerne gute Kreditkonditionen, und die Kosten sinken für alle.
Die BKW behauptet aber auch, sie wolle in erneuerbare Energien investieren.
Ja, aber sie tut das vor allem in Europa und kümmert sich nicht so sehr um die Versorgungssicherheit der Schweiz, ausser wenn es um die eigenen Wasserkraftwerke geht, die das Problem aber von der benötigten Menge her überhaupt nicht lösen können. Deshalb ist die Marktprämie viel sinnvoller, weil sie erstens die Winterstromproduktion zielgenauer absichern kann. Man muss sich dann nicht mit Vorab-Schätzungen der Preise begnügen, die sowieso nie zutreffen, weil sie im Ausland gemacht werden. Zweitens sind Auktionen mit gleitender Marktprämie viel offener für kleine Investoren ohne viel Kapital, und es entsteht richtiger Wettbewerb. Sie können mit ihren Dächern oder Zäunen mittelgrosse Anlagen erstellen und Hypotheken dafür aufnehmen, vorausgesetzt es gibt Sicherheit bei den Einnahmen dank Marktprämien. Auch kleine Anlagen auf Gebäuden sind äusserst sinnvoll, weil sie sich billiger ins Netz integrieren lassen. Die Anschlussleistung der bestehenden Leitungen wird meist ausreichen. Und drittens entsteht durch die gleitende Marktprämie mehr Preistransparenz. Die Grossen der Branche können nicht länger in irgendeinem Hinterzimmer des BFE Druck ausüben für eine Spezialbehandlung ihrer Anlagen.
Gibt es aus Ihrer Sicht Alternativen zu Ausschreibungen bei grossen PV-Anlagen?
Die Ausschreibungen mit gleitender Marktprämie brauchen keine Alternative. Die funktionieren in mehr als 100 Ländern, und das BFE ist schlecht beraten, wenn es behauptet, alles besser zu wissen. Varianten wären aber möglich. Beispielsweise Auktionen für PV-Anlagen kombiniert mit Speichern. Batterien brauchen wir eigentlich frühestens ab 2030. Kleine, wiederkehrende Testauktionen könnten Klarheit schaffen über die Kosten.
Und was ist mit den PV-Kleinanlagen?
Anlagen unter 150 kW, die nicht in die Auktionen fallen und nicht der Direktvermarktung unterliegen, brauchen vernünftige Rückliefertarife. Wir müssen schauen, dass wir für Otto Normalbetreiber die Vermarktungskosten niedrig halten. Über die Höhe der Rückliefertarife kann man immer streiten, aber es sollten mindestens jene 8 Rp./kWh Energietarif voll weitergegeben werden, die die Verteilnetzbetreiber von ihren gebundenen Kundinnen und Kunden einkassieren. Sich selbst schreiben die Verteilnetzbetreiber viel höhere Kosten gut, wenn sie investieren, zum Beispiel in neue Wasserkraftwerke mit garantierter Verzinsung von 3% bis 5% pro Jahr. Die Diskriminierung der Kleinen muss aufhören.
Warum gerade 8 Rp./kWh?
8 Rp./kWh – das entspricht dem mittleren Energietarif, den die Verteilnetzbetreiber heute verrechnen. Man könnte dies aber auch noch etwas höher festsetzen, wenigstens für die ersten 15 Jahre einer Anlage, aber dann wird die Administration komplexer. Einfacher wäre es, bei den Einmalvergütungen nachzubessern. Fassadenanlagen liefern im Winterhalbjahr fast gleich viel Strom wie Dächer, und das Potenzial an gewerblichen Bauten ist erwiesenermassen sehr gross. Darum könnten für sie die Investitionsbeiträge auf 60% erhöht werden, und das gäbe im Vergleich mit anderen Technologien noch immer sehr billigen Winterstrom.