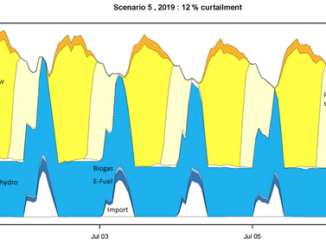Die energiepolitische Debatte scheint im Moment zweigeteilt. Auf der einen Seite wird mit viel Lärm und Schuldzuweisungen über mögliche Mangellagen im kommenden Winter debattiert. Auf der anderen Seite laufen die Debatten über den Ausbau der erneuerbaren Energien und den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen mit dem gewohnten Hickhack weiter. Es zeichnet sich hier bisher trotz der offensichtlichen Dringlichkeit keine Beschleunigung bei der Bewältigung der anstehenden energiepolitischen Herausforderungen ab.
Text: Beat Kohler
Drei Fragen an
Jürg Grossen, Nationalrat, Präsident glp Schweiz, Präsident Swissolar
Wie verändern die sich abzeichnende Strommangellage und der Ukrainekrieg die Debatte?
Die Debatte hat sich intensiviert. Endlich rücken wegen der höheren Energiepreise auch Effizienzmassnahmen im Strom- und Wärmebereich sowie intelligente Steuerungen für den Eigenverbrauch in den Fokus. Dort sehe ich auch den grössten Hebel, um kurzfristig reagieren zu können.
Reicht das Tempo der Anpassungen angesichts der Dringlichkeit der Probleme aus?
Das Tempo ist zu gering. Es rächt sich nun, dass die meisten Kantone bei der Umsetzung der MuKen mindestens fünf Jahre verschlafen haben. Das Tempo kann beim Zubau der erneuerbaren Energien und beim Heizungsersatz wegen der Lieferfristen und Personalressourcen nur mässig gesteigert werden. Nichtsdestotrotz müssen wir alles daransetzen, eine Tempoverschärfung hinzukriegen. Schneller geht es im Effizienz-, Steuer- und Regelbereich. Hier kann auch mit vergleichsweise rudimentären Lösungen viel erreicht werden. Jede Kilowattstunde, die wir nicht brauchen, ist sehr viel wert. Sie muss nicht produziert, nicht transportiert und auch nicht zwischengespeichert werden.
Gibt es Aspekte in der Energiedebatte, die mit der veränderten Lage mehrheitsfähig werden?
Förderbeiträge werden nun politisch besser akzeptiert, was sich zum Beispiel beim indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative zeigt. Zudem wächst im Parlament das Verständnis für die Effizienzmöglichkeiten immer mehr. Allerdings bleibt die parlamentarische Arbeit sehr langwierig und kompliziert, beispielsweise beim Mantelerlass. Dieser ist schon seit mehr als einem Jahr im Ständerat blockiert, obwohl mit den darin enthaltenen verbesserten Möglichkeiten für Quartierstromlösungen aus meiner Sicht am meisten erreicht werden kann.
Die Sorge, dass die Energie auch in der reichen Schweiz bald nicht mehr ausreichend vorhanden sein könnte, greift um sich. Es braut sich ein perfekter Sturm zusammen, angetrieben auf der einen Seite vom russischen Krieg in der Ukraine und auf der anderen Seite von den deutlichen Zeichen des Klimawandels, die jetzt für alle spür- und sichtbar sind. So konnte wegen des niedrigen Wasserstandes das Öl nicht mehr in der gleichen Menge über den Rhein in die Schweiz gebracht werden, und das AKW Beznau musste die Leistung drosseln, weil das Kühlwasser die Aare zu stark erwärmte. Entsprechend aufgeschreckt zeigt sich die Politik. Dabei ist das Thema Energie seit Jahren ein Dauerbrenner, und immer wieder werden neue Reformen und Gesetzesanpassungen diskutiert. Aktuell befasst sich das Parlament mit dem Mantelerlass, der Revision der Stromversorgungs- und des Energiegesetzes, die derzeit allerdings noch wenig ambitioniert ist. Obwohl die Probleme und Abhängigkeiten hinlänglich bekannt sind – die Schweiz deckt zwei Drittel ihres Gesamtenergiebedarfs mit importierten fossilen Energieträgern –, hat sich bisher aber zu wenig geändert. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Schweiz jährlich um die zehn Milliarden Franken für den Import fossiler Energien ausgegeben und dafür kaum etwas in den einheimischen Kraftwerkspark investiert. Trotz der unveränderten Abhängigkeit auch von russischem Gas und Öl sind jetzt viele von der drohenden Energieknappheit überrascht. So fordern diejenigen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien seit Jahren verzögern, jetzt einen Stromgeneral und viel Geld, um die Schweiz weiterhin fossil betreiben zu können.
Für den Winter bereits im Krisenmodus
Mitte Juli haben die Spezialisten des Bundes, der Elektrizitätskommission (ElCom) sowie der Strom- und Gasbranche über kurzfristige Massnahmen zur Stärkung der Versorgungssicherheit informiert. Bei der Stromversorgung spielt die Wasserkraft eine zentrale Rolle. «Der Füllstand der Speicherseen ist aktuell etwa im langjährigen Mittel», sagte Urs Meister, Geschäftsführer ElCom, vor den Medien. Das heisst, dass die Seen per 1. Juli zu 59 % befüllt waren. Damit dieses Wasser dann im Winter auch zur Verfügung steht, arbeitet die ElCom die Eckwerte für die Winterreserve aus. Speicherkraftwerksbetreiber sollen gegen Entgelt eine bestimmte Menge Energie zurückbehalten, die bei Bedarf abgerufen werden kann. Gemäss Meister soll die entsprechende Verordnung Anfang September finalisiert werden. Die ElCom gehe von einer Reserve von 500 GWh aus. Das soll im Notfall gegen Ende Winter helfen, das Netz zu stabilisieren, wird die Schweiz aber nicht über lange Zeit versorgen. Die Reserve entspricht nicht einmal einem Prozent des Gesamtjahresverbauchs der Schweiz im Jahr 2021. «Diese Wasserkraftreserve bringt keine zusätzliche Energie in das System», unterstrich Meister. Die Reserve eigne sich nicht, eine generelle Mangellage zu überbrücken. Deshalb betonte Michael Frank, Direktor des Branchendachverbands der Schweizer Stromwirtschaft VSE, dass die Gefahr einer Strommangellage gross sei, und machte Aufrufe, wie sie noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wären: «Wir alle müssen jetzt schon einen Beitrag leisten, indem wir kurzfristig weniger Strom und Gas brauchen – jede Kilowattstunde zählt, nicht nur die produzierte, sondern vor allem auch die eingesparte!» Nichts tun sei keine Option. Sollten blosse Sparappelle nicht mehr ausreichen, müsste der Bund Massnahmen im Rahmen von Verbrauchseinschränkungen ergreifen. «Nicht lebensnotwendige, energieintensive Anwendungen dürften dann nicht mehr verwendet werden», so Frank. Das könnten Schaufenster- oder Weihnachtsbeleuchtungen, aber auch Skilifte sein. In einem nächsten Schritt könnten auch Grossverbraucher gezwungen werden, Einsparungen zu machen. «Als Ultima Ratio würde der Bundesrat Netzabschaltungen beschliessen», stellte Frank in Aussicht. Strom gäbe es dann nur noch nach Fahrplan. Alle Massnahmen – auch die im Bereich Gasversorgung – sollen mithelfen, im nächsten Winter die ausserordentliche Lage aufgrund des Krieges in der Ukraine zu meistern. Nichts wird aber in naher Zukunft darum herumführen, die Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren und die einheimischen erneuerbaren Energien zu stärken. Nur so kann die Schweiz langfristig unabhängiger werden und auch die Klimakrise bekämpfen.
Trotzdem immer nur kleine Schritte
Drei Fragen an
Delphine Klopfenstein Broggini,
Nationalrätin, Grüne Genf, Mitglied des Bundesvorstandes der SSES
Wie verändern die sich abzeichnende Strommangellage und der Ukrainekrieg die Debatte?
Der Krieg in der Ukraine verdeutlicht die problematische Abhängigkeit der Schweiz von Öl und Gas. Die Energiewende muss nun beschleunigt werden, das ist der einzige Ausweg. Die Energiesouveränität zur Sicherung der Energieflüsse und zur Kontrolle der Preise, die wir seit Jahrzehnten propagieren, ergibt heute mehr Sinn denn je. Zwar ist die Anfälligkeit unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen heute klar erkennbar – und eine Mehrheit der Parteien ist sich darin einig –, doch Lösungen im Eiltempo können sehr gefährlich sein. Dies gilt insbesondere für die Rückkehr der Debatte über die Kernenergie, die man für begraben hielt, oder die Pläne für neue Gaskraftwerke, die uns langfristig in der Abhängigkeit halten würden. Angst führt oft zu falschen Antworten, und manche Parteien machen daraus leider ihre Stärke.
Reicht das Tempo der Anpassungen angesichts der Dringlichkeit der Probleme aus?
Das Tempo ist viel zu langsam, obwohl die Energiewende dank bestehenden und bewährten Lösungen in greifbarer Nähe ist. Beispielsweise könnte der zusätzliche Stromverbrauch aufgrund von Elektromobilität und Wärmepumpen durch einen massiven Ausbau der Photovoltaik gedeckt werden. Gleichzeitig muss der Bund Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs ergreifen, da das Potenzial enorm ist, es aber am politischen Willen der Mehrheit mangelt. Es ist bekannt, dass die billigste und umweltfreundlichste Kilowattstunde diejenige ist, die nicht verbraucht wird. Versorgungssicherheit bedeutet nicht, immer mehr zu produzieren, sondern die Energieverschwendung zu bekämpfen. Leider sind wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien weit zurückgefallen. Heute bräuchte es dringend mehr finanzielle Mittel, mehr ausgebildete Fachkräfte und eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren. Das ist in Reichweite, es bedarf nur der politischen Unterstützung.
Gibt es Aspekte in der Energiedebatte, die mit der veränderten Lage mehrheitsfähig werden?
Die Entwicklung erneuerbarer Energien wird im Allgemeinen nicht mehr bestritten. Es fehlt jedoch an einer starken Unterstützung. Die Solarenergie ist die Energie mit dem grössten Potenzial und sicherlich der besten Akzeptanz, vor allem im Vergleich zur Windkraft. Im Juni haben wir für den Grundsatz gestimmt, die Infrastruktur mit Sonnenkollektoren ausstatten zu können, was ein Etappensieg ist. Der Grundsatz, alle bestehenden und zukünftigen Dächer auszustatten, wird noch diskutiert, aber es herrscht eine gewisse Offenheit. Die aktuelle Diskussion dreht sich eher um die alpine Photovoltaik, die sich noch bewähren muss, insbesondere in Verbindung mit dem Schutz der Artenvielfalt. Die Kernenergie kommt durch die Hintertür zurück, findet aber heute keine Mehrheit, auch wenn sie viele öffentliche Debatten vergiftet. Energieeinsparungen durch Effizienz und Suffizienz bleiben die Stiefkinder der Debatte, obwohl das Potenzial enorm ist. Wir werden die Energiewende nicht schaffen, ohne unseren Verbrauch zu senken und einige unserer Lebensweisen zu ändern.
Dass der Umstieg auf erneuerbare Energien für die Schweiz vielfältige Chancen bietet, ist bekannt. Nicht nur die Versorgungssicherheit wird besser, sondern auch die Wertschöpfung in der Schweiz. Verschiedene Studien haben dies belegt. Klar ist auch, dass die Photovoltaik einen grossen Teil des Ausbaus tragen wird. Dennoch ist der Gesetzgeber bei der Förderung des Ausbaus der Photovoltaik nach wie vor zögerlich und geht in kleinen Schritten voran. Ein solcher Schritt war die Anpassung der Raumplanungsverordnung (RPV). Die neue RPV ist auf den 1. Juli in Kraft getreten. Damit soll es unter anderem möglich werden, künftig längerfristig bestehende Infrastruktur wie Lärmschutzwände, Parkplatzüberdachungen oder Autobahn- und Gleisböschungen für die Photovoltaik zu nutzen. Die neue RPV schafft erstmals die Möglichkeit, ausserhalb der Bauzone auch grössere PV-Projekte umzusetzen. Der Weg zu alpinen PV-Anlagen für die Winterstromproduktion in der freien Fläche bleibt allerdings noch weit, da grosse raumplanerische Hindernisse weiterhin bestehen. Hürden gibt es auch anderweitig. Das zeigt sich bei den Vernehmlassungen zu den zugehörigen Verordnungen zur parlamentarischen Initiative Girod. Es sollen einmal mehr neue Gefässe und Abläufe geschaffen werden, die keinen wesentlichen Mehrwert bringen. Das sorgt für Mehrkosten beim Bund und verlangsamt die Energiewende. Für Laien wird der Dschungel aus Regulierungen immer undurchdringlicher. Exemplarisch zeigt sich dies bei der Energieförderverordnung (EnFV). Immer mehr Ausnahmen werden aufgenommen, und Subventionen werden auch dort ausgeschüttet, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis alles andere als ideal ist. Das werde zu Mehrkosten führen, welche die weitere Realisierung von PV-Anlagen bremsen würden, befürchtet die SSES in ihrer Stellungnahme zur Verordnung (siehe auch Flash auf Seite 28). Ähnlich beurteilt die Schweizerische Energiestiftung die Anpassungen. Die Photovoltaik erhalte am wenigsten Geld pro zusätzliche Kilowattstunde. Auf der anderen Seite binde insbesondere die teure Förderung der Wasserkraft ohne Winterstromkomponente zu viele Mittel. Kritisch beurteilen beide Verbände auch die neuen Auktionen für PV-Anlagen ab 150 kW Leistung. Alle grösseren PV-Projekte konkurrieren um den Zuschlag für eine Einmalvergütung, wobei der Gebotspreis das einzige Kriterium zur Vergabe der Zuschläge ist. So werden realistischerweise nur einzelne Grossprojekte von der finanziellen Unterstützung profitieren können, während kleinere Projekte faktisch keine Förderung mehr erhalten werden. Das ist umso stossender, als grosse Anlagen schon jetzt konkurrenzfähig sind. Zudem werden Anlagen auf Bestandesbauten so kaum mehr einen Zuschlag erhalten, da bei einer Dachsanierung mit dem Bau der PV-Anlage erst begonnen werden kann, wenn die definitive Zusage der Auktion vorliegt. Dies sind nur einige der Kritikpunkte, die zeigen, dass trotz dem dringend notwendigen Ausbau der Photovoltaik die Verfahren länger und die Förderung komplizierter wird. Um dem entgegenzutreten, hat die SSES-Fachgruppe VESE das Fix- und Flexmodell in die Diskussion eingebracht. Dabei würde man sich mit seiner Anlage entweder dem Markt aussetzen oder von einer fixen, einheitlichen und langfristig stabilen Abnahmevergütung profitieren.
Das nächste Seilziehen hat schon begonnen
Bezüglich der langfristigen Ausrichtung und der grossen Linien der Energiepolitik ist seit dem Entscheid für die Energiestrategie 2050 wenig passiert. Beim CO2-Gesetz hat sich gezeigt, dass die Politik weiterhin blockiert ist. Immerhin hat der Nationalrat nun im Juni den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative verabschiedet. Diese verlangt, dass die Schweiz ab 2050 nicht mehr Treibhausgase ausstösst, als natürliche und technische CO2-Speicher aufnehmen können. Der indirekte Gegenvorschlag übernimmt mit dem Netto-null-Ziel für 2050 ein zentrales Anliegen. Er will jedoch kein explizites Verbot fossiler Energieträger. Weiter legt die Vorlage nationale Zwischenziele zur Emissionsverminderung bis 2050 fest und setzt Richtwerte für die Emissionsverminderung in den einzelnen Sektoren. Wie Marcel Hänggi vom Verein Klimaschutz Schweiz, der die Gletscher-Initiative lanciert hat, schreibt, beurteilt er den indirekten Gegenvorschlag der Umweltkommission des Nationalrats als besser als erwartet. Der Vorschlag dürfe aber im Verlauf der weiteren Debatte nicht wieder abgeschwächt werden, im Gegenteil. Einen Vorteil im Gegenvorschlag sieht Hänggi darin, dass bereits konkrete Massnamen enthalten sind. So müssten Unternehmen ihre Emissionen bis 2050 auf netto null senken. Unternehmen, die sich Netto-null-Fahrpläne gäben, würden vom Bund fachlich unterstützt und könnten von insgesamt 1,2 Milliarden Franken zur Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen profitieren. «Wir glauben, dass die Idee der Netto-null-Fahrpläne das Zeug dazu hat, strukturelle Veränderungen anzustossen», so Hänggi. Zudem sollen über zehn Jahre 200 Millionen Franken pro Jahr für ein Programm zum Ersatz fossil betriebener Gebäudeheizungen bereitstehen. Weiter soll der Bund Massnahmen zur klimaverträglichen Ausrichtung der Finanzmittelflüsse ergreifen. Die Debatte über den Gegenvorschlag wird trotz der aktuellen weltpolitischen und klimatischen Lage nicht einfach werden. So hat der Bundesrat bereits erklärt, dass er nichts von finanzieller Unterstützung für Unternehmen halte, weil sich der Bund das nicht leisten könne. Das Seilziehen hat also auch hier schon begonnen, und mit Blick auf die letzten Jahre ist trotz den veränderten Vorzeichen nicht zu erwarten, dass schnell griffige Massnahmen ins Auge gefasst werden. Nur wenn in künftigen Abstimmungen stabile Mehrheiten nicht nur grundsätzlich für den Klimaschutz und die Energiewende eintreten, sondern auch konkrete Massnahmen unterstützen, wird auch die Politik reagieren. Immerhin: Im Kanton Bern gab es ein sehr breite Zustimmung zum Klimaschutzartikel in der Kantonsverfassung. Noch klarer war die Zustimmung zu einem griffigeren Klimaschutzartikel im Kanton Zürich. Zumindest diese Zeichen dürfen für die nationale Debatte, die sich neben der Gletscher-Initiative auch mit dem neuen CO2-Gesetz befassen wird, als positiv gewertet werden.
www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210047